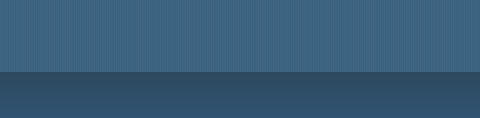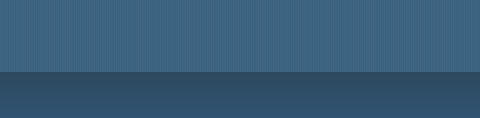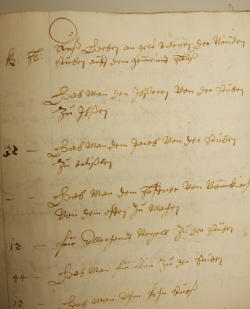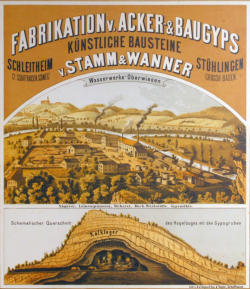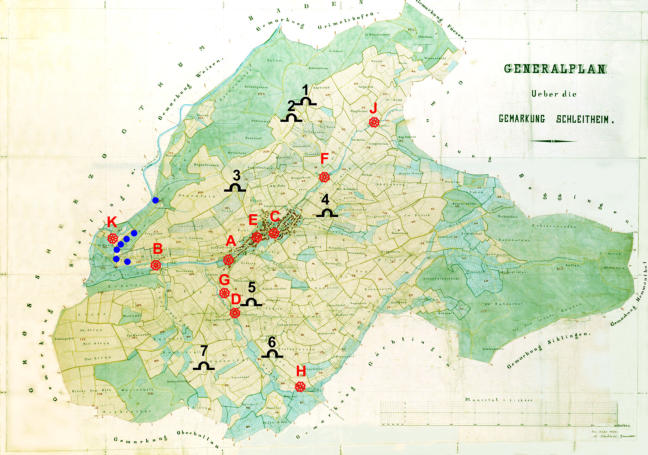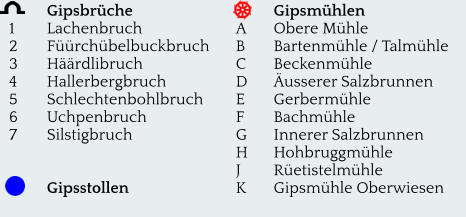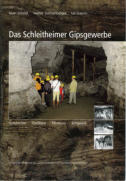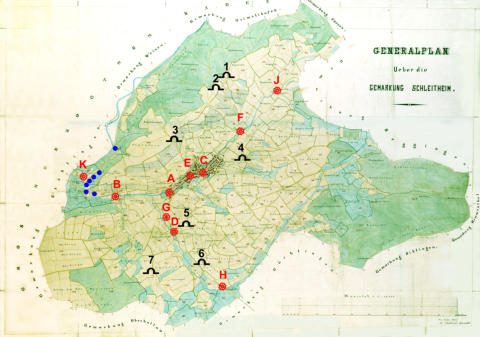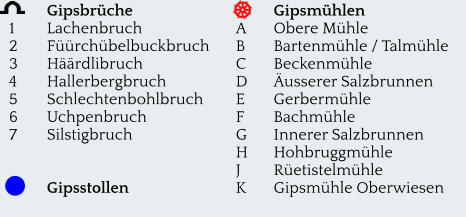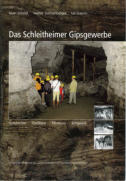Geschichte des Gipsabbaus in Schleitheim


Verputzfragmente, die in Villen der römischen Kleinstadt Iuliomagus gefunden
wurden, lassen vermuten, dass die hier im 1. Jh. unserer Zeitrechnung siedelnden
Römer Gipssteine gefunden und verarbeitet haben.
Erste schriftliche Hinweise auf die Verwendung von Schleitheimer Gips finden wir
im Staatsarchiv Zürich über eine 1709 erfolgte kleinere Lieferung an einen
Stuckateur, der beim Bau der Klosterkirche Rheinau beschäftigt war. Dieser Gips
wurde in Fässern als Gipsmehl, aber ungebrannt, geliefert und erst auf der
Baustelle, je nach benötigter Menge zu Baugips gebrannt. Erste schriftliche
Hinweise für die Verwendung von Gips in Schleitheim sind eine im
Gemeindearchiv aufbewahrte Rechnung aus dem Jahre 1712. Einem Hans Heinrich
Bächtold bezahlte man für das «Gemeindstuben Ibssen» neun Gulden. An anderer
Stelle wurden für «Ibss mallen», 24 Kreuzer ausgegeben. 1758 finden wir die
Bezeichnung eines «Gibsmann» Jakob Russenberger. Die dannzumal abgebauten
und verarbeiteten Quantitäten waren sicher noch sehr gering, wurde Gips doch
vorwiegend für Innenverputze und Feuerschutz um die offenen Herdstellen
verwendet. Auch konnte jeder der Gips (Keupergips) auf seinen Äckern fand, diesen
selber verwerten oder vermarkten.
Das änderte sich schlagartig, als Gips zu Düngezwecken gefragt war. Schriften des
Pfarrers Johann Friedrich Mayer, in Diensten des Fürstentums Hohenlohe, im Volk
bekannt unter dem Namen «Gipsapostel», wie z. B. «Lehre vom Gyps als vorzueglich
guten Dung zu allen Erd-Gewaechsen auf Aeckern und Wiesen, Hopfen- und
Weinbergen» Anspach 1768; 2. Aufl. 1769; fanden bald ihren Weg auch in die
Schaffhauser Landschaft. Das rasante Bevölkerungswachstum und die dadurch
zunehmende Nachfrage nach Lebensmitteln riefen nach intensiverer
Bewirtschaftung des knappen Ackerlandes. Die in der Dreifelderwirtschaft übliche
Brachzelg wurde aufgehoben und für den Anbau von Klee und Kartoffeln
freigegeben. Das erforderte vermehrte Düngung und mit den guten Ergebnissen
des «Gipsapostels» Mayer bot sich mit dem in Schleitheim in grosser Menge
vorhandenen Gipses die Gelegenheit, ein einträgliches Gewerbe aufzuziehen.
Sofort merkte auch die Gemeinde, dass mit «Ackergips» Geld zu verdienen war und
verpachtete Gemeindeland an Gesellschaften und interessierte Einzelpersonen.
Schleitheimer Gips fand seine Abnehmer nicht nur in der näheren Umgebung.
Gipslieferungen erfolgten bis in den Bodenseeraum, ins Zürcher Weinland und in
die Badische Nachbarschaft. Johann Heinrich Imthurn schrieb 1865 in seiner Schrift
über das landwirtschaftliche Düngewesen: Schleitheim wurde zum «Zentrum der
Gipsproduktion der Ostschweiz», «da sowohl Gipsvorkommen von guter Qualität,
als auch die Verarbeitung sowie der Handel gegeben waren». 70 Prozent des
Schleitheimer Gipses wurde an die Landwirtschaft verkauft, welche ihn
«ungekocht» (ungebrannt) als Dünger oder zur Konditionierung stark lehmhaltiger
«schwerer» Böden einsetzte.
Zur Zeit der Hochblüte waren rund 120 bis 150 Personen im Gipsgewerbe
beschäftigt und um die 100 Pferde standen für die Transporte zu den Abnehmern
im Einsatz. Auch das restliche Schleitheimer Gewerbe verdiente mit am Gipsabbau.
Hufschmiede, Wagner, Futtermittellieferanten und auch das Gastgewerbe kamen
zu willkommenen Einnahmen. Die grösste Abbaumenge wurde im Jahre 1860 mit
180 000 Zentnern (rund 9000 Tonnen) erreicht.
Schon 1790 wurde der erste Gipsabbaustollen in der Halde in Oberwiesen in den
Berg getrieben. Mit der steigenden Nachfrage nach Ackergips wurden immer mehr
Abbaukonzessionen beantragt und weitere Stollen in der «Halde» angelegt. So
datiert der heute noch begehbare Besucherstollen von 1860. Mit der Ansiedelung
von verschiedenen Industriebetrieben in Oberwiesen, wurde auch eine moderne
Gipsfabrik mit Mühle, Brennerei und Gipssteinfabrikation in unmittelbare Nähe der
Stollen gebaut. Ein 1872 eigens angelegter Fabrikkanal lieferte die Wasserkraft für
die diversen Betriebe.Die zunehmend aufkommende Verwendung von
Kunstdünger in der Landwirtschaft liess die Nachfrage nach dem Naturprodukt
Gips drastisch sinken. Dazu kamen neue, restriktive, Zollvorschriften, welche die
Ausfuhr von Gipsprodukten nach Deutschland massiv verteuerten. 1904 verkauften
die Besitzer der Gipsfabrik die gesamte Anlage an die Gipsunion AG in Zürich. Diese
legte das Werk zuerst einmal still, da Streitigkeiten mit der Gemeinde Schleitheim
über die weitere Gültigkeit der Abbaukonzession in den Stollen nicht
einvernehmlich geregelt werden konnten.
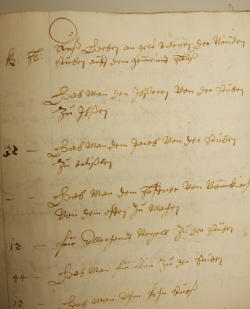
Rechnung aus dem Jahre 1712

Rüetistelmühle

Stollenplan
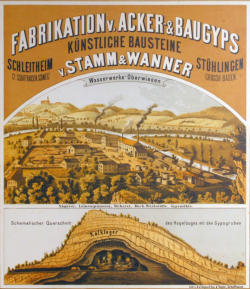





1908 übernahm Christian Stamm, der zuvor in den Diensten des Vizekönigs von
Ägypten als Hofgärtner tätig gewesen war, den heutigen Besucherstollen, um darin
ein Obstlager einzurichten. Christian Stamm liess in Oberwiesen eine Obstplantage
mit über 6000 Edelobstbäumen anlegen, benötigte dann einen kühlen, dunkeln Ort
für die Einlagerung der Früchte und befand dafür den brachliegenden Gipsstollen
als geeignet. Für die Kontrolle und Sortierung der verschiedenen Obstsorten baute
Stamm unmittelbar vor dem Stolleneingang das heute als Museum dienende
Gebäude. Der Zugangsstollen und die zur Lagerung ausgewählten Stellen wurden
mit Ziegelsteinen ausgemauert und mit einem dicken Kalkmörtelverputz versehen
(Überreste davon sind heute noch zu sehen). Die Temperatur im Stollen liegt
ganzjährig bei ca. 10° C, die relative Luftfeuchtigkeit bei ca. 85%, keine optimalen
Vorrausetzungen für die längerfristige Lagerung von Obst, das dann auch schnell zu
faulen begann. Stamm gab aber noch nicht auf und liess einen Lüftungsschacht
anlegen, der die Feuchtigkeit aus den Lagerstollen in die Atmosphäre hätte abführen
sollen.Auch das brachte nicht den erhofften Effekt. Christian Stamm verkaufte Obst-
und Gemüsebau an einen einheimischen Gärtner.
Christian Stamm hat aber mit seinen robusten Stollensicherungsarbeiten, ungewollt,
den bis heute erhaltenen Zugang zum Gipsbergwerk für die Nachwelt gesichert. Die
sieben weiteren Stollen mit einer Länge von 1700 lm in der Halde haben dem Zahn
der Zeit nicht standgehalten. Die Zugänge sind eingestürzt und überwachsen, und
nur die alten Pläne und die zahlreichen Dolinen im Hang zeigen und lassen erahnen,
wo früher Gips abgebaut wurde.
1919 kaufte J. G. Stamm, Buchdrucker, von der Witwe des unterdessen verstorbenen
Christian Stamm, Gipsstollen mit Obstkeller, Vorbau und Umgelände. 1927 kam es
zum Pachtvertrag für einen weiteren Gipsabbau mit der Gemeinde. J. G. Stamm
wollte in der sich abzeichnenden Wirtschaftskrise einige Arbeitsplätze schaffen und
der Strassenbahn von Schaffhausen nach Schleitheim Transportaufträge vermitteln.
Abnehmer des Gipsgesteins waren die Portland-Cementwerke in Thayngen. 1930
verstarb J. G. Stamm. Eine Erbengemeinschaft führte den Betrieb weiter und konnte
1935 den Abbau von 1200 Tonnen Rohgips verzeichnen. 1936 wurde von dieser ein
letzter Stollen angeschlagen und bis 1944 bewirtschaftet. Absatz- und
Rentabilitätsschwierigkeiten sowie die übermächtige Konkurrenz durch den
wesentlich billigeren Tagebaubetrieb, führten schliesslich zum endgültigen Aus für
das Schleitheimer Gipsgewerbe.
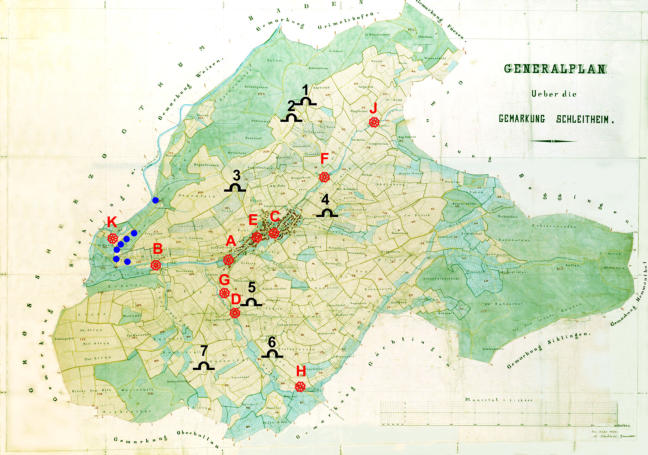
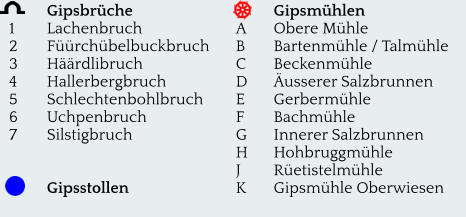
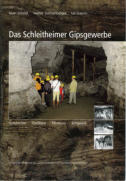
Das Schleitheimer Gipsgewerbe
Broschüre ISBN Nr.3-9522515-8-5
Erhältlich im Gipsmuseum
oder im Buchhandel